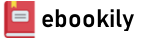Dieses Lehrbuch eröffnet einen alternativen Zugang zur Physik und bietet eine konsistente Einführung in die relevanten Themen der klassischen Physik. Anders als in vielen Physikbüchern wird hier die grundlegende Methode der Physik am Beispiel einer vorläufigen Theorie des Lichtes erläutert und daran anknüpfend die Geometrische Optik und die Relativitätstheorie aufgebaut. Von den mathematischen Anforderungen stützt es sich damit auf bekanntes Schulwissen.
Erst im Anschluss werden die Mechanik auf den Erhaltungsgrößen Impuls und Energie entwickelt und die wichtigsten Konzepte aus Kinematik und Dynamik bis hin zur Kontinuumsmechanik dargestellt. Von dort gelingt ein fließender Übergang in die Thermodynamik, wo mit der thermischen Energie erstmals eine nicht-mechanische Energieform eingeführt wird. Besonderes Augenmerk wird dabei von Anfang an auf die Entropie gesetzt, die als extensive Zustandsvariable der thermischen Energieform den Schlüsselbegriff der Thermodynamik darstellt.Als Nächstes werden unter den Schlagwörtern „chemische Energie“ und „elektrische Energie“ zwei weitere Beispiele für nicht-mechanische Energieformen vorgestellt. Zwei weiterführende Kapitel über Transportphänomene und Wellen runden die Darstellung ab.
Die jeweiligen mathematischen Kenntnisse werden parallel zu den physikalischen Inhalten eingeführt und erweitert sowie teilweise in ergänzenden Kapiteln zusammenfassend bereitgestellt. Kürzere philosophische Betrachtungen und Histörchen aus der Physikgeschichte lockern die Darstellung auf. Insbesondere eignet sich das Buch für Studierende als Ergänzung zur Physik-Vorlesung und für Lehrende der Physik, die einen neuen Zugang für ihre Lehre suchen.
Author(s): Romano Rupp
Edition: 1
Publisher: Springer Spektrum
Year: 2022
Language: German
Pages: 424
Tags: Classical Physics; Theory of Light; Geometric Optics; Theory of Relativity; Thermodynamics; Chemical Energy; Electrical Energy
Vorwort
Danksagung
Inhaltsverzeichnis
1 Methoden der Physik
1.1 Hypothesen
1.2 Mathematik
1.3 Quantifizierung
1.4 Näherung
1.5 Präparation und Messung
1.6 Messunsicherheit
1.7 Präzisierung
2 Geometrische Optik
2.1 Reflexion und Brechung
2.1.1 Reflexionsgesetz
2.1.2 Brechungsgesetz
2.1.3 Brechung an zwei ebenen Flächen
2.1.4 Snelliussches Brechungsgesetz
2.2 Bilder
2.2.1 Das physikalische Bild
2.2.2 Zentralprojektionen
2.2.3 Planspiegel
2.2.4 Theorie der perfekten strahlenoptischen Abbildung
2.3 Sphärische optische Elemente
2.3.1 Sphärische Spiegel
2.3.2 Linsen
2.3.3 Das Auge
2.4 Optische Instrumente
2.4.1 Unmittelbar aufeinanderfolgende Linsen
2.4.2 Brille und Lupe
2.4.3 Fernrohr und Mikroskop
2.4.4 Petzvals Revolution der Geometrischen Optik
3 Kinematik
3.1 Raum
3.1.1 Lineare Koordinatentransformationen
3.1.2 Äquivalenzprinzip für gedrehte Bezugsrahmen
3.2 Zeit
3.2.1 Uhren
3.2.2 Einsteinsche Uhrensynchronisation
3.3 Differentialrechnung (M1)
3.4 Geschwindigkeit und Beschleunigung
3.5 Spezielle Relativitätstheorie
3.5.1 Galileisches Äquivalenzprinzip
3.5.2 Die Postulate der Speziellen Relativitätstheorie
3.5.3 Transformation der Geschwindigkeit
3.5.4 Transformation der Ereigniskoordinaten
3.5.5 Transformation der Beschleunigung
3.5.6 Zeitdilatation
3.5.7 Ereignisintervalle
3.5.8 Newtonsche Kinematik
4 Mechanik
4.1 Geschwindigkeit von Wirkungsausbreitungen
4.2 Grundbegriffe der Mechanik
4.3 Erhaltungsgrößen
4.3.1 Bedingung der Möglichkeit von Erhaltungsaussagen
4.3.2 Grundlegende Erhaltungsgrößen der Mechanik
4.3.3 Stoßprozesse
4.3.4 Messverfahren für die Masse
4.4 Die Postulate der Mechanik
4.5 Innere Energie
4.5.1 Ruhesystem
4.5.2 Definition der inneren Energie
4.5.3 Laborsystem
4.5.4 Zwillingsparadoxon
4.5.5 Äquivalenz von Masse und Energie
4.6 Kinetische Energie
4.6.1 Zerfall eines physikalischen Systems
4.6.2 Inelastischer Stoß
4.7 Grenzfälle der Mechanik
5 Phänomenologische Mechanik
5.1 Potentielle Energie
5.1.1 Warum braucht man die potentielle Energie?
5.1.2 Die Postulate der phänomenologischen Mechanik
5.1.3 Potenzreihen für empirische Zusammenhänge
5.1.4 Das Hookesche Gesetz
5.1.5 Phänomene der Schwere
5.1.6 Platons Höhlengleichnis und die Phänomenologie
5.2 Integralrechnung (M2)
5.3 Leistung
5.4 Partielle Ableitung und Potential (M3)
5.5 Mechanische Systeme
5.5.1 Definition eines mechanischen Systems
5.5.2 Konservative Wechselwirkungen
6 Dynamik
6.1 Differentialgleichungen (M4)
6.2 Bewegungsgleichungen
6.3 Freier Fall
6.4 Schwingungen
6.4.1 Hookescher Oszillator
6.4.2 Experimentelle Untersuchung von Oszillatoren
6.4.3 Die Schwingungsgleichung harmonischer Oszillatoren
6.4.4 Mathematisches Pendel
6.4.5 Gekoppelte Oszillatoren
6.4.6 Rückkopplung
6.4.7 Resonanz
6.4.8 Begrenzung der Resonanzamplitude
6.5 Kraft
6.5.1 Newtonsche Bewegungsgleichung
6.5.2 Actio gleich reactio
6.5.3 Hamilton-Funktion
6.5.4 Zustandsdiagramme
6.6 Arbeit
7 Dissipation
7.1 Dissipativ gedämpfte Schwingungen
7.2 Warum zeigen makroskopische Systeme Dissipation?
7.3 Dissipationskinetik
7.4 Bewegung in dissipativen Medien
7.5 Wie fallen Körper in dissipativen Medien?
7.6 Reibungskraft
7.7 Mechanisches Gleichgewicht
8 Kontinuumsmechanik
8.1 Elastizität
8.1.1 Dehnung
8.1.2 Reine Formänderungen
8.1.3 Kompressibilität
8.2 Grenzflächenphänomene
8.2.1 Grenzflächenenergie
8.2.2 Haftung
8.2.3 Dissipation an Grenzflächen
8.3 Mechanische Materiemodelle mit mehreren Freiheitsgraden
8.3.1 Intensive Zustandsvariable
8.3.2 Fundamentalform der Energie
8.4 Druck
8.4.1 Druckausgleich
8.4.2 Schweredruck eines Fluids
8.4.3 Hydraulische Transformatoren
8.5 Enthalpie
8.5.1 Mechanische Enthalpie
8.5.2 Auftrieb
8.6 Konjugierte Variable
9 Thermodynamik
9.1 Die Hauptsätze der Thermodynamik
9.1.1 Physiker und ihre Verbotstafeln
9.1.2 Arbeit und Wärme
9.2 Das Standardmodell der Thermodynamik
9.2.1 Offene Systeme im Standardmodell
9.2.2 Transformation von Zustandskoordinaten
9.2.3 Nomenklatur thermodynamischer Prozesse
9.2.4 Die Enthalpie im Standardmodell
9.3 Kalorimetrie
9.3.1 Der Äquivalenzsatz der Thermodynamik
9.3.2 Charakterisierung von Entropieänderungen
9.3.3 Messprinzip der Kalorimetrie
9.4 Thermometrie
9.4.1 Thermisches Gleichgewicht
9.4.2 Thermoskope und Grad-Thermometer
9.4.3 Thermodynamische Kreisprozesse
9.4.4 Messung des Verhältnisses zweier Temperaturen
9.4.5 Definition der Temperatureinheit
9.5 Thermische Materialeigenschaften
9.5.1 Kompressibilität
9.5.2 Thermische Ausdehnung
9.5.3 Wärmekapazität
9.5.4 Joulescher Expansionskoeffizient
9.6 Zustandsgleichungen und Prozessgleichungen
9.6.1 Allgemeine thermische Zustandsgleichung
9.6.2 Van-der-Waals-Zustandsgleichung für Fluide
9.6.3 Zustandsgleichung für verdünnte Gase
9.6.4 Adiabatische Prozessgleichungen für verdünnte Gase
9.7 Geräte und Maschinen
9.7.1 Wirkungsgrad
9.7.2 Heizgeräte
9.7.3 Maschinen
9.7.4 Wärmepumpen und Kälteanlagen
10 Chemie
10.1 Chemische Grundgesetze
10.2 Stoffmenge
10.3 Das ideale Gas
10.4 Chemisches Potential
10.5 Reaktionsenthalpie
10.6 Freie Enthalpie (Gibbs-Enthalpie)
10.7 Phasenumwandlungen und elementare chemische Reaktionen
11 Elektrizität
11.1 Reibungselektrizität
11.2 Ladung und Potential
11.3 Thermoelektrische Energieumwandlungen
11.3.1 Spontane Richtung des Ladungstransports
11.3.2 Potentialausgleich
11.3.3 Elektrische Heizung
11.3.4 Thermoelektrische Generatoren und Thermoelemente
11.4 Elektrochemische Energieumwandlungen
11.4.1 Galvanische Zelle
11.4.2 Elektrolyse
11.5 Elektrische Maßeinheiten
11.6 Kapazität
11.6.1 Korrektur elektrischer Messungen
11.6.2 Elektrische Energie eines Kondensators
12 Transport
12.1 Ströme
12.2 Leistungsabgabe und Stromstärke
12.3 Widerstand
12.3.1 Messung elektrischer Widerstände
12.3.2 Messbereichserweiterung
12.4 Felder im Eindimensionalen
12.4.1 Skalarfelder
12.4.2 Vektorfelder
12.5 Gradient und Divergenz (M5)
12.5.1 Gradient
12.5.2 Divergenz
12.5.3 Gaußscher Integralsatz (eindimensional)
12.6 Die differentielle Kontinuitätsgleichung
12.6.1 Stromdichte- und Geschwindigkeitsfeld
12.6.2 Impulsdichte und kinetische Energiedichte eines Fluids
12.6.3 Transport in Stoffgemischen
12.7 Bernoulli-Gleichung und Euler-Gleichung
12.8 Stromdichten als Folge von Gradienten skalarer Felder
12.9 Osmose, Dialyse und Brennstoffzellen
13 Perturbationen
13.1 Lineare Diffusionsgleichungen
13.2 Lineare Wellengleichungen
13.3 Lösungen linearer Perturbationsgleichungen
13.3.1 Allgemeine Lösung für die lineare Wellengleichung
13.3.2 Lösungsstrategie für Wellen- und Diffusionsgleichungen
13.3.3 Superpositionsprinzip
13.3.4 Anfangs- und Randbedingungen
13.3.5 Der Begriff der Welle
13.4 Schwebung und Interferenz
13.5 Anregungsenergie nichtdissipativer Perturbationen
13.6 Energie- und Impulstransport durch Wellen
13.7 Schallwellen
13.8 Lichtwellen
14 Anhang
14.1 Optische Systeme mit zwei dünnen Linsen
14.2 Geometrie der Raumzeit
14.3 Legendre-Transformation
Literatur
Stichwortverzeichnis